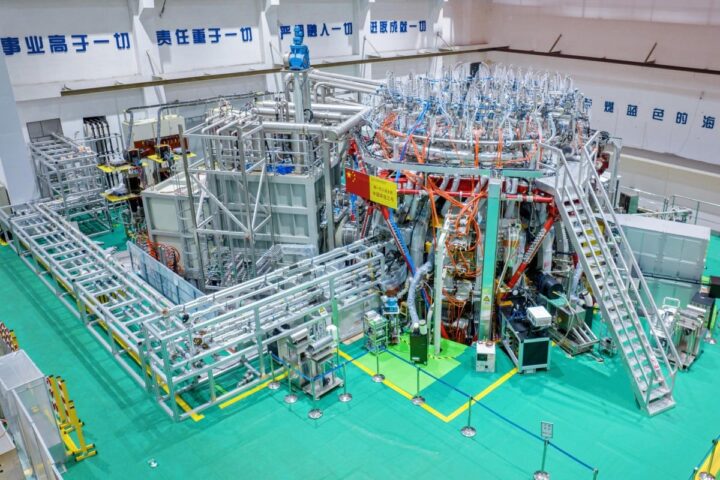Die Bauindustrie steht zunehmend unter Druck, ihren enormen CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Besonders im Fokus: Zement, dessen Herstellung für etwa acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Ein überraschender Ansatz für eine nachhaltigere Lösung kommt nun aus deutschen Forschungslabors – und zwar aus einer Quelle, die bislang kaum jemand im Blick hatte: Klärschlamm.
Forschende der RWTH Aachen und des Leibniz-Instituts für Werkstofforientierte Technologien in Bremen arbeiten gemeinsam mit Industriepartnern daran, Klärschlammasche als teilweisen Ersatz für Zement zu nutzen. Die Initiative läuft unter dem Projektnamen ReArrange und könnte die Bauwirtschaft revolutionieren.
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft
Bei der Abwasserreinigung fällt Klärschlamm in großen Mengen an – allein in Deutschland jährlich rund zwei Millionen Tonnen. Dieser Schlamm wird oft verbrannt, wobei eine mineralstoffreiche Asche entsteht. Diese enthält silikatische und aluminatische Bestandteile, die in ihrer chemischen Struktur dem Zement erstaunlich ähnlich sind. Genau hier setzen die Forschenden an: Anstatt die Asche zu deponieren, soll sie in der Betonproduktion verwendet werden – als umweltfreundlicher Ersatz für einen Teil des Zements.
Erste Laborversuche und Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse. Bei optimaler Aufbereitung und Mischung kann die Klärschlammasche bis zu 20 % des Zements in Beton ersetzen – ohne signifikanten Qualitätsverlust bei der Druckfestigkeit.
Das CO₂-Einsparpotenzial ist enorm: Für jede Tonne Zement, die ersetzt wird, können rund 800 Kilogramm CO₂ vermieden werden. Damit ließe sich – bei flächendeckender Anwendung – ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz leisten. Gleichzeitig wird ein Stoffkreislauf geschlossen: Was bisher als Abfall galt, wird zu einem funktionalen, regional verfügbaren Rohstoff. Damit leistet die Lösung auch einen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Kreislaufwirtschaft im Bauwesen.
Klärschlamm fehlt noch Zulassung
Trotz aller Euphorie gibt es noch Hürden: Die Qualität von Klärschlamm variiert je nach Herkunft stark. Um die Asche als Baustoff einsetzen zu können, muss sie genau analysiert, homogenisiert und normgerecht aufbereitet werden. Zudem stehen regulatorische Anpassungen an – aktuell ist Klärschlammasche als offizieller Zementersatz in Deutschland noch nicht vollumfänglich zugelassen.
Die RWTH Aachen setzt in ihrem Forschungsansatz auf eine gezielte thermochemische Behandlung des Schlamms, um möglichst stabile und schadstofffreie Ascheprodukte herzustellen. Das langfristige Ziel: eine standardisierte, industriell einsetzbare Lösung, die sich sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich lohnt.
Mehr zu Architektur
Wir berichten über architektonische Fortschritte, unterschiedliche Baumaterialien und Entwicklungen in Richtung umweltfreundlicher Bauweisen. Mit folgenden Links gelangst du der Reihe nach zu mehr Artikel in diesem Themenbereich für Einsteiger bis zu Profis.
- Good News: Das erste klimaneutrale Zementwerk der Welt
- 6 umweltfreundliche Alternativen zu Zement
- Wie Klärschlamm das Bauen nachhaltiger machen könnte
Bild: Emma Houghton auf Unsplash