Dass sich Unternehmen an einer nachhaltigen Entwicklung für die Gesellschaft und die Umwelt einsetzen wird für Konsumenten immer wichtiger. Daraus entstand der Begriff Corporate Social Responsibility (CSR), oder auch unternehmerische Sozialverantwortung. Sie bezeichnet einen freiwilligen Beitrag von Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung bzw. nachhaltigem Wirtschaften.
Parallel zu CSR ist jedoch auch die Praktik des „Greenwashing“ entstanden. Darunter versteht man Methoden von manipulativem Marketing und selektiver Kommunikation. Sie soll dem Konsumenten suggerieren, dass ein Unternehmen oder ein Produkt umweltfreundlich oder fair gehandelt ist, um somit dem Unternehmen ein „grünes“ Mäntelchen umzuhängen. In Wahrheit wird jedoch häufig ein kleiner positiver Anteil hervorgehoben, während die restliche Herstellung wesentlich schädlicher ist. Oder die Werbung hebt ein besonderes Produkt hervor, aber kommuniziert nicht, dass die restlichen Produkte des Unternehmens weiterhin die Umwelt zerstören.
Auch bestimmte Zertifizierungen können oft irreführende Aussagen darüber liefern, wie nachhaltig etwa Lebensmittel oder Kleidungsstücke tatsächlich produziert wurden.
Auswirkungen des Greenwashing
Greenwashing ist aus mehreren Gründen sehr problematisch. Es stellt nicht nur ein stark verzerrtes Bild der Realität dar und wiegt die Konsumenten in gutem Gewissen. Zusätzlich wird es für Konsumenten immer schwerer, zu erkennen und zu entscheiden, was nun wirklich wie nachhaltig oder nicht nachhaltig produziert wird. Außerdem haben die wirklich nachhaltig produzierenden Unternehmen es immer schwerer, sich von Greenwashing-Methoden zu differenzieren.
Die ultimative Auswirkung ist aber natürlich, dass viele Firmen weiterhin nichts an ihren, oft ausbeuterischen und zerstörerischen Praktiken, ändern müssen, und somit weiterhin die Umwelt und die Menschen in der Produktionskette darunter leiden.

Greenwashing erkennen
Wie aber können wir Greenwashing-Methoden tatsächlich erkennen? Eine vollständige Liste wird es wohl nie geben, und auch nicht immer eindeutig erkennbare Merkmale. Hier ist jedoch eine Liste an hilfreichen Hinweisen.
Fehlende oder unseriöse Zertifizierungen
Nur weil Unternehmen ihre Produkte als „nachhaltig“ oder „ökologisch“ oder „natürlich“ bezeichnen, bedeutet das gar nichts. Diese Begriffe dürfen frei genutzt werden. Ohne Zertifizierungen sind diese Aussagen schwer bis gar nicht nachprüfbar.
Und auch wenn Zertifizierungen abgedruckt sind, ist das nicht automatisch ein Freibrief, dass alles gut ist. Es gibt frei erfundene Zertifizierungen, die verwendet werden um einen seriösen Eindruck zu machen. Und auch bei den existierenden Zertifizierungen ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass diese lediglich eine eingeschränkte Liste an Prüfungen beinhalten. Global2000 hat hier ein hilfreiches Übersichtsdokument über Zertifizierungen und Gütesiegel erstellt.
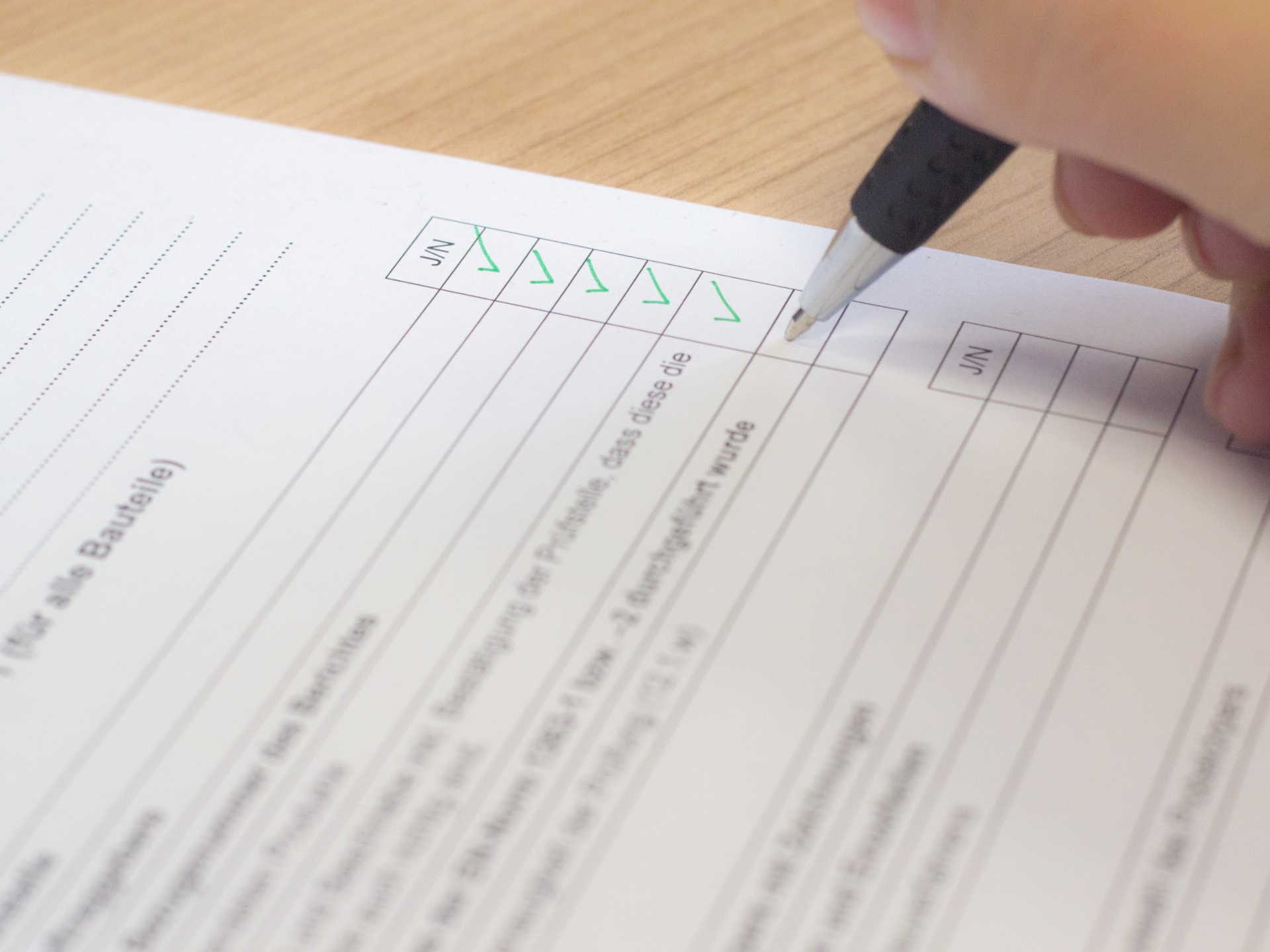
Ablenkungen und Vergleiche
Wenn Autos etwa als „benzinsparend“ präsentiert werden, oder mit speziellen Filtern ausgestattet sind, wird hier vom wesentlichen Aspekt abgelenkt, dass Autofahren in jedem Fall umweltschädlich ist. Auch Hybrid- oder Elektroautos haben etwa in der Produktion und mit ihren Batterien einen negativen Einfluss auf die Umwelt.
Auch Aufkleber wie „Vegan“ auf Obst und Gemüse, das vom anderen Ende der Welt hierher transportiert wurde, lenkt von diesem umweltbelastenden Aspekt ab, und liefert keinerlei Aussage über das Produkt, die wir nicht ohnehin schon wissen.
Ablenkung bzw. Irreführung ist es auch, wenn etwa Nespresso damit wirbt, dass die Kapseln recycelt werden können. Es wird jedoch tunlichst vermieden zu erwähnen, dass sie aus umweltschädlichem Aluminium hergestellt werden.
Assoziation mit nachhaltigen Marken
Immer öfter schließen Konzerne auch Partnerschaften mit anderen Unternehmen oder auch bekannten Einzelpersonen, die bestimmte Werte repräsentieren. Dadurch wird bei Konsumenten eine Werte-Assoziation hervorgerufen, die jedoch nichts über die tatsächlichen Praktiken aussagt.
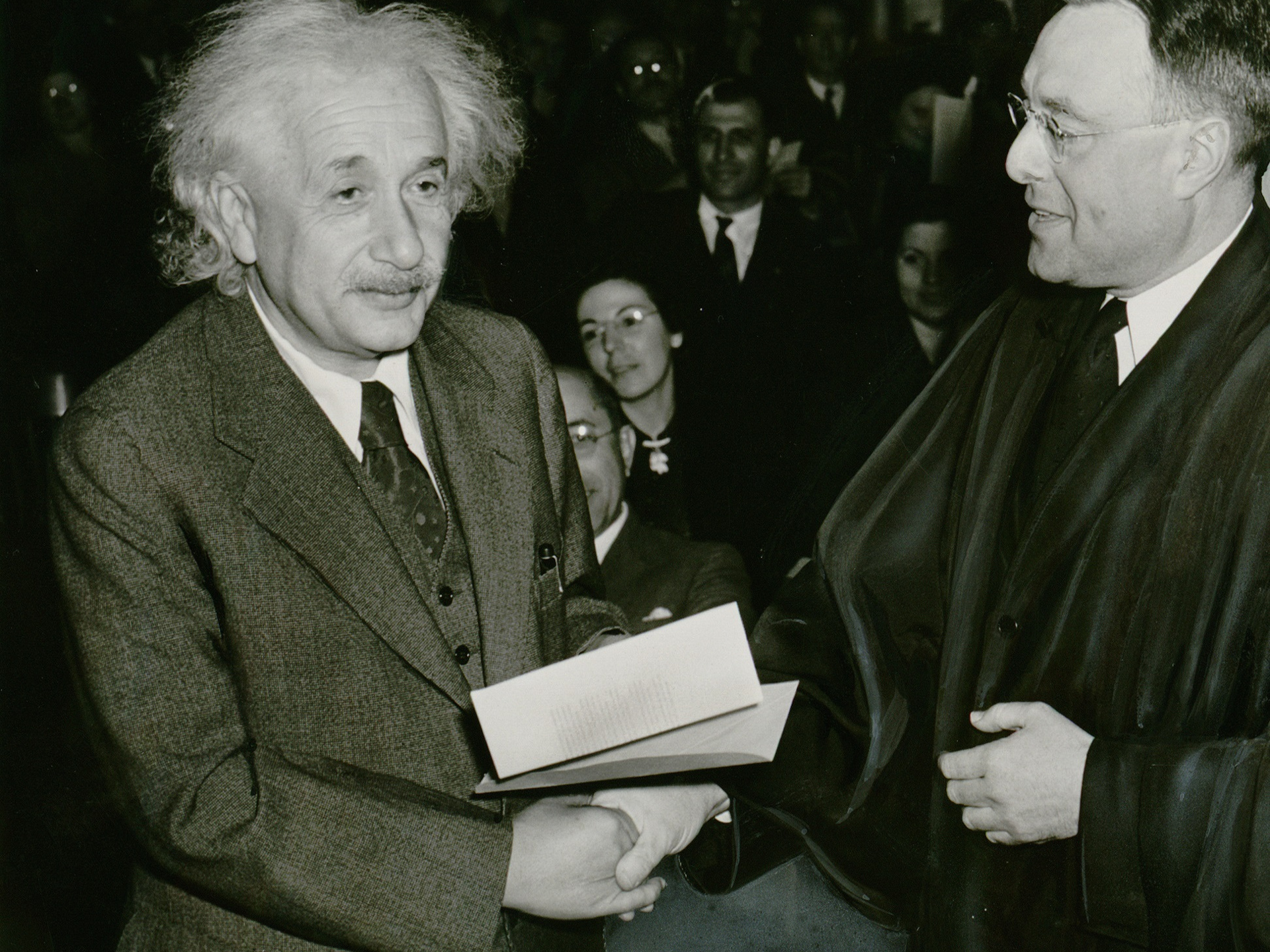
Was tun?
Als Konsument können wir vor allem die Werbung und Kommunikation der Unternehmen auf diese Aspekte noch wesentlich kritischer betrachten. Auch das genaue Informieren über diverse Zertifizierungen und Siegel und was dahinter steckt ist wichtig.
Zusätzlich können wir in unseren Worten und Taten nicht nur an die Unternehmen, sondern auch in sozialen Medien und an die Politik kommunizieren, dass wir diese Irreführungen nicht einfach hinnehmen und akzeptieren.
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat außerdem eine App entwickelt, wo Zertifizierungs-Siegel eingelesen werden können, und man genau erfährt, was dahinter steckt. Weiters können wir als Konsumenten irreführende Werbungen auch beim Verbraucherschutz melden, wodurch möglicherweise rechtlich dagegen vorgegangen werden kann.
Fazit
Auch beim Greenwashing können wir oft das Gefühl bekommen, ohnehin nicht wirklich viel verändern zu können. Vor allem, wenn dann auch noch Berichte bekannt werden, dass Bio oft gar nicht so „bio“ ist, wie wir denken. Oder dass an immer neuen Ecken und Enden versucht wird, Abkürzungen zu nehmen, die auf Kosten anderer oder der Umwelt passieren.
Wichtig ist aus meiner Erfahrung, dass wir darauf achten, dass wir unseren eigenen Ansprüchen und Werten treu bleiben, und auf ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Produktion zu bestehen, bzw. diese einzufordern. Information ist der erste Schritt, Aktion der zweite.
Weiterführende Links
Futerra greenwash guide (englisch)
Global2000.at Gütesiegelcheck
konsument.at Greenwashing Hinweise
NABU: “Siegel-Check” App









